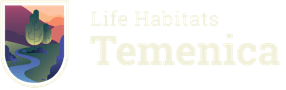Am 30.1.2020 war ich schon wieder im Teil des Lebensraums Temenica. Mein Wünsch war es, einen Spaziergang durch die Lehmgruben zu machen, aber wurde wegen des gefrorenen Bodens und teilweise geschmolzenen oberen Bodenschicht davon abgebracht. Deshalb entschied ich mich für einen Spaziergang durch das Wäldchen neben der Straße, die Siedlungen Hruševec und Brezje verbindet. Dies ist ein Eichen-Weißbuchen-Wäldchen, das in einigen Teilen auch ein wenig erhöht und mit Fichte bewachsen ist. In nördlicher Richtung steigt es aber ein wenig in einen Schlingengrabenteil mit Wasserquelle ab. Das Grabenwasser steigt in Zeit der heftigen Niederschläge deutlich an und hält sich in solcher Höher länger an. An beiden Seiten begleiten das Wäldchen teilweise Wiesen- und Feldoberflächen.
Während des Spaziergangs wurde ich auch diesmal auf Pilze und Flechte aufmerksam, vor allem aber auf die invasive Sorte. Schon am Anfang des Weges wurde meine Aufmerksamkeit von zwei Strauchsorten gefesselt, und zwar der Lorbeerkirsche (Prunus laurocerasus)

und der Gewöhnlichen Mahonie (Mahonia aquifolium).

Beide sind immergrüne Sorten und beliebte Sträucher, die aus den Gärten in die Natur gelangten, wahrscheinlich durch die Samen, die Vögel mit Ausscheidungen verbreiteten. In diesem Teil ist auch eine invasive Baumsorte sehr verbreitet, und zwar der Eschen-Ahorn (Acer negundo).

In seinen Baumkronen waren auch Früchte mit Samen, die sich geflügelte Nüsse nennen und noch jetzt geflügelt sind. Diese Ahornbäume wachsen sehr schnell, was bedeutet, dass das Holz weicher und sehr spröde ist. Für ältere Bäume ist es gewöhnlich, dass sie gebrochene Spitzen haben. Die Blicke hielten sich am meisten an den Baumstämmen der hier anwesenden Flechtensorten auf. Flechten sind wichtige Bioindikatoren des verschmutzten Lufts. Als sauberste Umgebungen gelten Gebiete, an denen Strauchflechten wachsen. Gebiete, wo man Laub- und Krustenflechten findet, sind weniger sauber. Diesmal bemerkte ich keine Strauchflechten, aber Laub- und Krustenflechten waren anwesend. Unter Laubflechten treten vor allem die Stern-Schwielenflechte (Physcia stellaris)

und die Zweifelhafte Schwielenflechte (Parmelia subrudecta).

Ich bemerkte die Schwielenflechte auf einem der abgefallenen Eichenäste, was darauf deutet, dass die Flechtenthalli vor allem auf den Ästen in Baumkronen entwickelt sind. Separat bemerkte ich auch die Gewöhnliche Gelbflechte (Xanthoria parietina),

die in die Gruppe der nitrophilen Flechten gehört, und die Echte Lungenflechte (Lobaria pulmonaria),

die sehr empfindlich auf die verschmutzte Luft ist. An Weißbuchenstämmen waren größere Krustenflechtengruppen der Weißen Blatternflechten (Phlyctis argena).

Aus derselben Flechtengruppe ist auch die Schriftflechte (Graphis scripta) interessant.

An einzelnen Eichenstämmen war die bleichgrüne Kuchenflechte (Lecanora expallens) anwesend.

Auf dem trockenen Holunderstumpf erblickte ich die Holunderpilze (Auricularia auricula-judae),

Diese saprophytische Sorte ist in Slowenien relativ häufig. Weil sie essbar ist, wird sie häufig in chinesischen Suppen verwendet und ist auch eine bekannte Sorte in der chinesischen Medizin. Danach erregte meine Aufmerksamkeit ein Milchfleck auf dem abgestorbenen Holz. Dies war der Milchweiße Eggenpilz (Irpex lacteus),

der auf der Ast- und Stammrinde von abgestorbenen Laubbäumen vorkommt. Wegen ihn zerfällt das angegriffene Holz noch weiter. Mit einer reichen Farbenvielfalt erfreute mich auch die Schmetterlings-Tramete (Trametes versicolor).

Auch diese Sorte gehört zum Saprophyten bzw. Zersetzern. Auf dem abgestorbenen Kirschstämmchen bemerkte ich die Holzschwämme der Samtigen Tramete (Trametes pubescens).

Sie wachsen auf abgestorbenen Laubbaumästen und -stämmen in Laubwälder. Besonders aufmerksam war ich auf den Gemeinen Spaltblättling (Schizophyllum commune)

mit charakteristisch gespalteten Blättern des Fruchtkörpers, der sich als Parasit auch in Bienenstöcken, beschädigten Eichen und Erlen sowie anderen Laubbäumen befindet. Mit seiner Farbenpracht erfreute mich am Ende auf dem verlassenen Fichtescheit auch der Saprophyt-Pilz Orangentremor.

Als der Pilz im Sommer austrocknet, ist er fast farbenlos.